Herausforderung FMCG-Daten
.webp)

.webp)
Smarte Lösungen für datengetriebenes Wachstum
Der FMCG-Markt ist schnell und komplex. Hersteller und Händler sitzen auf einem Datenschatz, der Umsatz, Marktanteile und Kundenzufriedenheit massiv beeinflussen kann. Mit BI- und Data-Warehousing-Lösungen werden Rohdaten zu handlungsfähigen Insights, Category Management läuft smarter, Außendienstprozesse effizienter und Out-of-Stock-Situationen lassen sich proaktiv vermeiden.
Ein Regal voller Marken, ein Kunde, der spontan entscheidet, und ein Markt, der schneller rotiert als viele Dashboards aktualisiert werden können – das ist die Realität im FMCG-Geschäft heute. Hersteller und Händler stehen unter Druck: Preiskämpfe, schwankende Absatzkurven und neue Wettbewerber im Regal machen Planung und Steuerung zur ständigen Herausforderung.
Hinzu kommt das dynamische Shopper-Verhalten: Konsumenten wechseln schneller denn je zwischen Marken, nutzen parallel stationäre und digitale Kanäle und lassen sich von Trends inspirieren, die über Nacht viral gehen können. Für Hersteller und Händler bedeutet das: Planungssicherheit ist heute fast ein Ding der Unmöglichkeit.
Daten sind elementar für FMCG-Branche
Wer in diesem Umfeld erfolgreich sein will, kann sich nicht mehr nur auf Bauchgefühl und Erfahrung verlassen. Wie auch in anderen Sektoren, sind Daten in der FMCG-Branche zur härtesten Währung geworden. Market Intelligence ist kein „nice-to-have“, sondern ein unverzichtbares Werkzeug, um das gemeinsame Ziel der Hersteller und Händler zu erreichen: das richtige Produkt, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort und zum richtigen Preis.
“Market Intelligence ist kein „nice-to-have“, sondern ein unverzichtbares Werkzeug.”
Daten zu Umsatz, Marktanteilen oder Drehzahlen aus einem Meer von Informationen und Kennzahlen und aus unterschiedlichen Quellen liegen in der Regel vor. Doch daraus die entscheidenden Insights zu generieren und diese intelligent in konkrete Maßnahmen zu übersetzen, ist leichter gesagt als getan.
Hersteller vs. Händler: Gleiche Basis, andere Perspektiven
Obwohl Hersteller und Händler teils sehr verschiedene Kennzahlen im Fokus haben, gibt es immer wieder Schnittmengen in der Analyse. Und genau hier liegt der Schlüssel: Trotz unterschiedlicher Perspektiven verfolgen beide Seiten letztlich dasselbe Ziel, nämlich Umsatzpotenziale bestmöglich auszuschöpfen und den Shopper zufriedenzustellen.
Hersteller richten ihren Blick in erster Linie auf Marken- und Produkt-Performance, Marktanteile und Distributionsausbau. Für sie ist entscheidend zu verstehen, wie Performance-Unterschiede zu erklären sind und welche Maßnahmen in welchem Ausmaß zu Abverkaufserfolgen beitragen.
Händler wiederum denken stärker aus der Kategorie- und Sortimentslogik heraus: Welche Artikel verdienen mehr Regalfläche? Welche Sortimente decken die Nachfrage optimal ab? Wo blockieren schwach performende Produkte wertvolle Flächen?
Das Spannende dabei: Beide Seiten nutzen oft dieselben Datenquellen, etwa NielsenIQ- oder GfK-Daten, interpretieren diese jedoch aus sehr unterschiedlichen Blickwinkeln. Während ein Hersteller die „Rotation“ eines Artikels als Indikator für Produktstärke sieht, versteht ein Händler darunter ein Signal für die Effizienz seiner Regalnutzung.
Praxisbeispiele machen deutlich, was passiert, wenn beide Seiten auf derselben Datengrundlage arbeiten: Category-Management-Initiativen, die Herstellerwissen über Produkt-Performance mit Händlerdaten zur Bedarfsdeckung kombinieren, führen zu besseren Regalplänen, spürbaren Umsatzsteigerungen und zufriedeneren Shoppern.
Dass sich diese Zusammenarbeit lohnt, bestätigen auch Studien: Laut McKinsey und NIQ können datengetriebene Kooperationen zwischen Herstellern und Händlern Umsatzsteigerungen von 3 bis 5 % allein durch optimierte Sortimentsentscheidungen und gezieltere Promotion-Planung ermöglichen. Professionelles Datenmanagement wirkt hier als Katalysator und macht aus reinen Zahlen handlungsrelevante Insights.
Hersteller und Händler, die datengetrieben agieren, können ihre Entscheidungen präziser treffen, Prozesse effizienter gestalten und Wachstumschancen gezielt nutzen. Doch wie gelingt das konkret? Die Antwort liegt in modernen Technologien: Business-Intelligence-Tools (BI) und Data-Warehousing-Systeme (DWH) sind längst mehr als technische Hilfsmittel. Sie ermöglichen die zentrale Aufbereitung und Visualisierung von Daten aus unterschiedlichsten Quellen, von POS-Daten über Nielsen- und GfK-Panels bis hin zu internen Absatz- und Logistikkennzahlen. So werden komplexe Datenlandschaften greifbar, und Insights lassen sich deutlich schneller in operative Maßnahmen übersetzen.
Market Intelligence wird dabei zum entscheidenden Wettbewerbsvorteil. Wer Trends früh erkennt, Nachfragepotenziale richtig einschätzt und Sortimente sowie Promotions datenbasiert optimiert, verschafft sich einen Vorsprung, sowohl im direkten Wettbewerb als auch in der Zusammenarbeit zwischen Herstellern und Händlern. Wie das auf Basis moderner Technologien gelingen kann, zeigen wir im Folgenden.
Das Dilemma mit Nielsen und GfK
Nielsen und GfK liefern wertvolle Daten, doch sie stecken meist in komplexen, proprietären Formaten. Für Unternehmen bedeutet das:
- Schwer zugängliche Datenstrukturen: Der Export ist kompliziert und zeitaufwendig.
- Fehlende Kompatibilität: Moderne BI-Tools können diese Daten oft nicht direkt anbinden und verarbeiten.
- Abhängigkeit von Anbietertools: Die Software ist selten so flexibel und benutzerfreundlich, wie es Unternehmen brauchen.
Die Folgen sind klar: hoher manueller Aufwand in Analytics-Abteilungen, verzögerte Entscheidungen, fehlerhafte Ableitungen, verpasste Chancen.
Viele Daten, viele Herausforderungen
In vielen FMCG-Unternehmen sind Daten im Überfluss vorhanden. Ihr wertvolles Potenzial entfaltet sich jedoch nur, wenn der Umgang damit gelingt. Doch genau hier nehmen viele Unternehmen große Herausforderungen wahr. Der Grund liegt selten in der Menge, sondern fast immer in der Nutzbarkeit. Bevor Zahlen tatsächlich in handfeste Erkenntnisse verwandelt werden können, müssen sie aufwendig manuell exportiert, aufbereitet und aus verschiedenen Systemen zusammengeführt werden. Dieser Prozess kostet nicht nur Zeit, sondern bindet auch enorme Ressourcen in den Analytics-Abteilungen.
Was dabei auf der Strecke bleibt, ist die Geschwindigkeit. Analysen, die im Tagesgeschäft kurzfristig datengetriebenes Handeln ermöglichen sollen, ziehen sich über Tage oder gar Wochen hin. In dieser Zeit entstehen verpasste Chancen: Out-of-Stock-Situationen bleiben unentdeckt, weil Warnsignale im Datendschungel untergehen, und Wettbewerber besetzen freie Regalflächen, noch bevor eigene Maßnahmen greifen. Auch wichtige KPI-Zusammenhänge bleiben häufig verborgen, weil die Komplexität der Daten eine korrekte Interpretation erschwert.
Es ist paradox: Obwohl alle notwendigen Informationen vorhanden sind, erreichen sie die Entscheider oft zu spät. Was eigentlich als Wettbewerbsvorteil gedacht ist, wird so zum Risiko. Erst wenn Daten nutzbar gemacht werden – automatisiert, integriert und in Echtzeit abrufbar – können sie ihre volle Wirkung entfalten. Dadurch wird das ersehnte datengetriebene Wachstum von einem Buzz-Word zur gelebten Unternehmenskultur.
BI und Data Warehousing: Der Gamechanger im FMCG
Die Antwort auf die Herausforderungen im FMCG-Markt liegt in modernen Business-Intelligence- und Data-Warehousing-Systemen. Sie verwandeln isolierte Datensilos in eine zentrale Wissensbasis, die für alle Beteiligten zugänglich und nutzbar ist. Dadurch können Unternehmen aus Rohdaten wertvolle Insights ableiten, und zwar schneller, effizienter und zuverlässiger als je zuvor.
“Die Antwort auf die Herausforderungen im FMCG-Markt liegt in modernen Business-Intelligence- und Data-Warehousing-Systemen.”
Ein zentraler Vorteil ist die verbesserte Datenzugänglichkeit: Durch die Anbindung aller relevanten Quellsysteme, von Nielsen- und GfK-Panels über Drotax-, POS-Daten bis hin zu ERP-Systemen, an ein zentrales BI-System stehen Informationen aus allen Quellen an einem Ort zur Verfügung. Unterschiedliche Abteilungen und Teams arbeiten so auf derselben, verlässlichen Datenbasis.
Transparente und effizientere Entscheidungsprozesse sind ein weiterer entscheidender Effekt. Benutzerfreundliche Dashboards und Reports, erstellt mit Tools wie Power BI oder Tableau, ermöglichen es Fachbereichen, Analysen selbstständig durchzuführen und Daten direkt für operative oder strategische Entscheidungen zu nutzen. Marketing, Vertrieb und Category Management können so unmittelbar auf Marktbewegungen reagieren.
Darüber hinaus sorgt die automatisierte Datenaufbereitung für erhebliche Entlastung in den Analytics-Abteilungen. Routinetätigkeiten wie ETL-Prozesse (Extract, Transform, Load) laufen im Hintergrund: Daten werden bereinigt, zusammengeführt und aufbereitet. Zeitaufwand und Kosten sinken spürbar, während die Qualität der Analysen steigt und die Entscheidungen schneller und datenbasiert getroffen werden können.
Durch die Kombination von zentraler Datenhaltung, benutzerfreundlichen Visualisierungs-Tools und automatisierten Prozessen kann nicht nur das Tagesgeschäft bei Herstellern und Händlern profitieren, sondern auch die Zusammenarbeit dieser deutlich verbessert werden. Marktkennzahlen und Performance-Indikatoren werden einheitlich interpretiert, gemeinsame Entscheidungen auf Basis konsistenter Daten getroffen.
Mit BI- und DWH-Lösungen entsteht so eine belastbare Basis für fundierte, datengetriebene Entscheidungen, die Wettbewerbsvorteile bringen. Unternehmen können Trends frühzeitig erkennen, Sortimente gezielt optimieren und schneller auf Veränderungen im Markt reagieren. Im Folgenden findest du einige Praxisbeispiele, die dir veranschaulichen, welche Effekte datengetriebenes Handeln bewirkt.
Use Case 1: Datengetriebenes Category Management im Handel
Ein klassisches Problem im Handel zeigt sich oft erst, wenn man die Regale genauer betrachtet: Topseller sind nicht ausreichend präsent, während Produkte mit niedriger Drehzahl wertvolle Regalfläche blockieren. Für Händler bedeutet das verpasste Umsatzpotenziale und unzufriedene Kunden, die ihre Wunschprodukte nicht finden.
Hier kommen moderne BI- und Data-Warehousing-Systeme ins Spiel. Mit einem datenbasierten Category Management werden solche Schwächen sichtbar. Durch die Verbindung von Nielsen- und GfK-Daten mit internen POS-Informationen können Händler Umsatz, Drehzahlen und Bedarfsdeckung je Filiale und Kategorie analysieren. Auf einen Blick wird deutlich, welche Produkte besonders erfolgreich sind und welche den Umsatz nur geringfügig beeinflussen.
Sehr wertvoll sind Szenario-Simulationen: Sie zeigen, wie sich Umsatz und Nachfrage verändern, wenn Regalflächen neu verteilt oder Sortimente angepasst werden. So lässt sich zum Beispiel erkennen, dass ein Topseller in der Regalfläche unterrepräsentiert ist, während ein schwächeres Produkt unverhältnismäßig viel Platz beansprucht. Auf Basis dieser Erkenntnisse können gezielte Maßnahmen ergriffen werden, von Flächenumverteilungen über Sortimentsbereinigungen bis hin zu Optimierungen in der Promotionplanung.
Die Vorteile sind unmittelbar spürbar: Regalflächen werden effizienter genutzt, Umsatzpotenziale werden besser ausgeschöpft, und Kunden finden die Produkte, die sie tatsächlich kaufen möchten. Gleichzeitig ermöglicht die verbesserte Datenarbeit, die Maßnahmen auf Filial-, Regional- oder sogar Outlet-Ebene anzupassen, inklusive Alerts für Marktleiter, sobald bestimmte KPI-Schwellen überschritten werden.
Use Case 2: Vertriebssteuerung für Hersteller
Für Hersteller ist der Außendienst ein entscheidender Hebel, um Umsatz zu steigern und Marktanteile auszubauen. Täglich besuchen Außendienstmitarbeiter zahlreiche Filialen. Doch nicht jede Filiale bringt den gleichen Effekt für Umsatz und Marktanteil. Die zentrale Frage lautet daher: Welche Filialen bieten den größten Hebel, und wie lassen sich Ressourcen optimal einsetzen?
Ein modernes, datengetriebenes Planungstool liefert hier die Antwort. Es kombiniert Abverkaufsdaten aus Nielsen- oder GfK-Panels mit Informationen zu regionalen Umsatzpotenzialen sowie der aktuellen Wettbewerbssituation, etwa Preispositionierungen, Regalplatzierungen und Promotionaktivitäten der Wettbewerber. Auf dieser Grundlage werden die sogenannten Fokusfilialen identifiziert, also die Standorte, an denen gezielte Maßnahmen den größten Einfluss auf Umsatz und Marktanteil haben.
Darüber hinaus optimiert das System automatisch die Tourenplanung der Außendienstmitarbeiter. Reiserouten werden so gestaltet, dass Fahrtzeiten minimiert, Prioritäten gesetzt und die wichtigsten Filialen effizient besucht werden. Gleichzeitig werden Filialen hervorgehoben, bei denen durch gezielte Maßnahmen noch weiteres Umsatzpotenzial gehoben werden kann.
Der Nutzen ist klar messbar: Außendienst-Ressourcen werden effizienter eingesetzt, die Fahrzeit reduziert, und die Aktivitäten tragen nachweislich zur Steigerung von Marktanteilen bei. Durch die datenbasierte Planung lassen sich strategische Entscheidungen präzise umsetzen, Wachstumschancen schneller erkennen und operative Maßnahmen optimal steuern.
Use Case 3: Out-of-Stock – Umsatzverluste auf der Handelsfläche vermeiden
Out-of-Stock-Situationen stellen Hersteller und Händler gleichermaßen vor erhebliche Probleme. Sobald Produkte im Regal fehlen, entstehen direkte Umsatzverluste, entweder weil die Artikel nicht verkauft werden können oder weil Shopper auf Alternativen des Wettbewerbs ausweichen. Besonders umsatzstarke Produkte wie Topseller oder Aktionsartikel bergen ein enormes Umsatzpotenzial, das bei Regallücken ungenutzt bleibt.
Ein zusätzliches Problem: Viele Händler und Hersteller reagieren erst, wenn der Schaden bereits eingetreten ist. Die manuelle Analyse von Verkaufszahlen und Beständen dauert oft mehrere Tage, sodass wertvolle Zeit verstreicht, in der Umsatz verloren geht und Kunden möglicherweise dauerhaft zu Wettbewerbern wechseln. In einem dynamischen FMCG-Markt mit stark schwankender Nachfrage kann diese Verzögerung entscheidend sein.
Moderne Out-of-Stock-Lösungen kombinieren Echtzeit-Überwachung mit automatisierten Bestellvorschlägen, um Regallücken frühzeitig zu vermeiden. Dabei werden POS-Daten mit Lagermengen und Nachbestellzeiten verknüpft, wobei historische Verkaufsdaten wie Wochenzeiten, Saisonabhängigkeit oder regionale Unterschiede berücksichtigt werden.
Ein zentraler Bestandteil ist der Einsatz von Predictive Analytics. Auf Basis vergangener Verkaufszyklen und prognostizierter Nachfrage lassen sich Bestandsrisiken frühzeitig erkennen. Das System erzeugt Alerts für Händler oder Außendienstmitarbeiter, sobald ein Out-of-Stock-Szenario droht, sodass proaktive Maßnahmen möglich werden. Gleichzeitig können Nachbestellprozesse automatisiert werden, um Lieferkettenströme rechtzeitig zu aktivieren und Bestände kontinuierlich auf einem optimalen Niveau zu halten.
Die Vorteile solcher datengetriebenen Lösungen sind umfassend: Out-of-Stock-Raten werden deutlich reduziert, der Umsatz mit verfügbarer Ware maximiert, und saisonale Nachfragesteigerungen können proaktiv adressiert werden. Gleichzeitig steigt die Kundenzufriedenheit, da Konsumenten die gewünschten Produkte zuverlässig im Regal vorfinden. Durch die Kombination von Echtzeitdaten, Prognosen und automatisierten Prozessen wird Out-of-Stock-Management von einer reaktiven Notfallmaßnahme zu einem strategischen Instrument für Umsatz- und Marktanteilssteigerung.
Wie Hersteller und Händler den FMCG-Markt mit BI meistern
Der FMCG-Markt ist schnelllebig, komplex und hart umkämpft. Hersteller und Händler sitzen auf einem riesigen Datenvorkommen. Doch Rohdaten allein schaffen noch keinen Wettbewerbsvorteil. Entscheidend ist, wer diese Daten systematisch analysiert, verknüpft und in intelligente Business-Entscheidungen überführt.
Moderne Business-Intelligence- und Data-Warehousing-Lösungen sind hier der Türöffner. Sie verwandeln unstrukturierte Daten in handlungsfähige Insights, verbessern die Market Intelligence erheblich und schaffen Transparenz über alle Kanäle hinweg. Damit wird Category Management smarter, der Außendienst effizienter und das Out-of-Stock-Management proaktiver. Hersteller und Händler können Trends frühzeitig erkennen, Promotions gezielter planen und ihre Ressourcen optimal einsetzen.
“Nur wer Fachkenntnis in der FMCG-Branche mit Erfahrung in der technischen Integration von Daten kombiniert, kann individuelle, praxisnahe Lösungen auf Best-Practice-Basis entwickeln.”
Besonders wichtig ist die datengetriebene Zusammenarbeit zwischen Herstellern und Händlern. Gemeinsame Kennzahlen, transparente Datenflüsse und integrierte Analysen ermöglichen abgestimmte Maßnahmen, die Umsatz, Marktanteile und Kundenzufriedenheit steigern. Wer in diese Strukturen investiert, sichert sich nicht nur höhere Umsätze, sondern auch die Loyalität der Konsumenten und einen klaren Vorsprung vor der Konkurrenz.
Die Komplexität moderner BI-Systeme und die Integration von Datenquellen wie Nielsen oder GfK machen die Expertise einer spezialisierten BI-Beratung essenziell. Nur wer Fachkenntnis in der FMCG-Branche mit Erfahrung in der technischen Integration von Daten kombiniert, kann individuelle, praxisnahe Lösungen auf Best-Practice-Basis entwickeln. So entsteht eine Lösung, die nicht nur die Daten versteht, sondern auch das Regal genauso smart macht wie die Informationen dahinter.

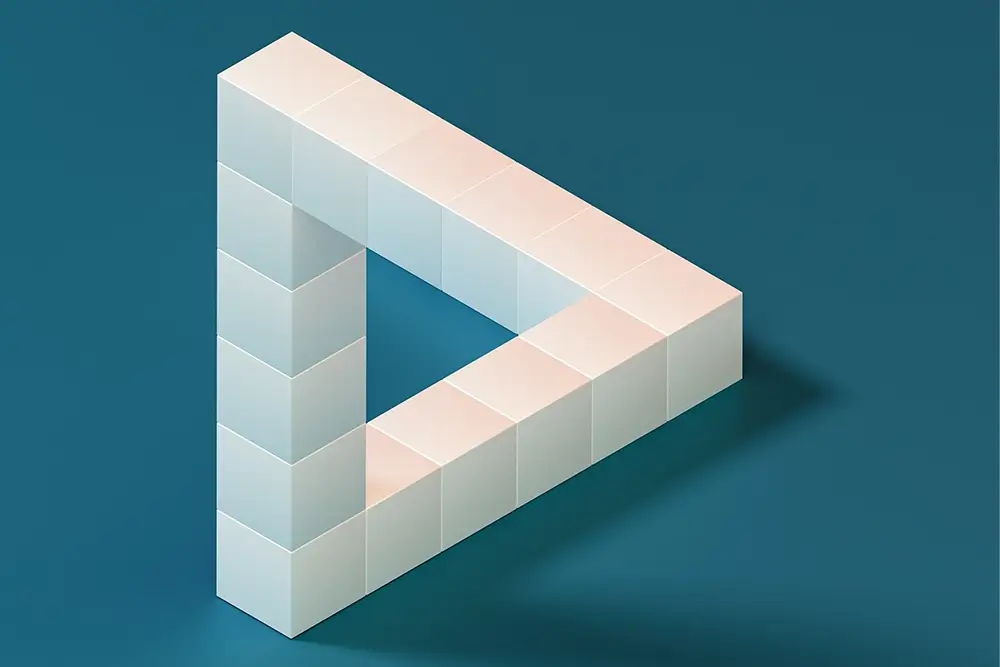




%20(1).webp)
